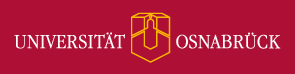Hauptinhalt
Topinformationen
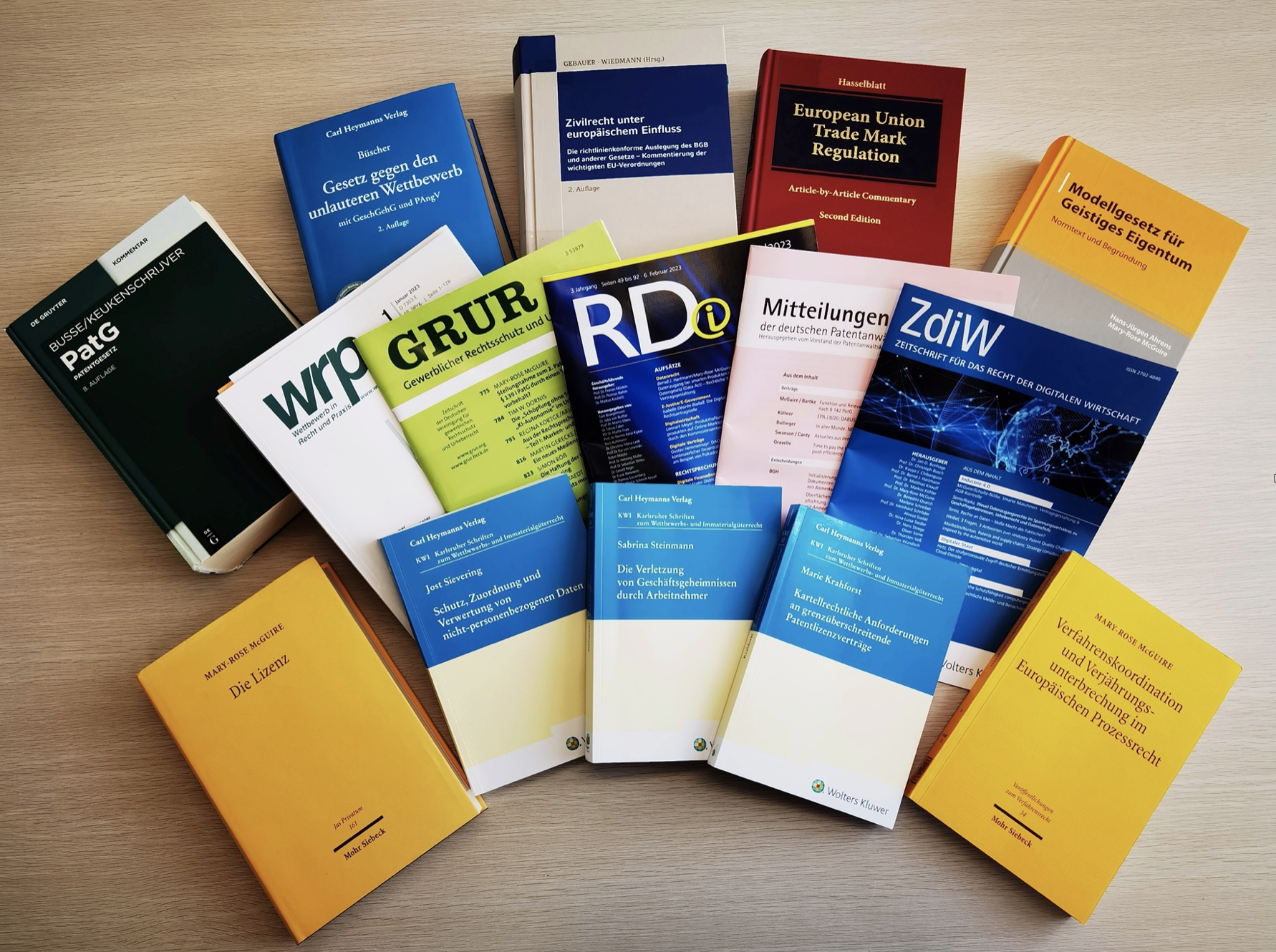
Hinweis: Zu einigen Publikationen finden Sie unter Aktuelles kurze Zusammenfassungen & eine Verlinkung zu der Fundstelle.
Publikationen
Eine Liste mit den Publikationen von Frau Prof. Dr. McGuire finden Sie hier.
Aktuelle Publikationen des Lehrstuhlteams
Patentrecht & Lizenzvertragsrecht
Geheimnisschutz
Digitale Tools (inkl. smart farming)
sonstige Publikationen